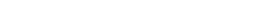

BORNEO - 1002. Nacht

Als ich eines Tages nach einer üppigen Mahlzeit gemütlich auf einer Parkbank in Miri lag, meldete sich der Forscherdrang. Letztlich war ich nicht hierher gekommen, um mir eine Wampe anzufressen, sondern den Kopfjägern einen Besuch abzustatten. Wo sind die bloß? Allein durfte ich nicht nach ihnen suchen, weil - nicht was man so denkt - man die Stadt in Richtung Urwald nicht verlassen darf, ohne sich einen Führer anzuheuern (ab hier Guide für politisch Korrekte bzw. Liebhaber der Denglischen Sprache).
Damals gab es in Miri Guides für etwa 12 US$ am Tag - wegen der Wirtschaftskrise. Der Guide hat einen nicht nur geführt, sondern bekocht und sogar mit Jagdbeute beglückt. Kaum zu glauben, dass man Vollpension für ein Dutzend Dollars bekommt. Leider Vollpension Holzklasse im wahrsten Sinne des Wortes, und all inclusive, sofern man sich mit Flusswasser zufrieden gibt. Die Bank im Park war ein Ausbund an Komfort gegenüber den späteren Schlafstätten. Das war mir zwar nicht bekannt, aber mir schwante so einiges.
Um nicht vollends in Armut zu enden, legte ich mir einen Luxus-Guide zu. Er hieß Chefs de Mulu und sah bewaffnet aus wie ein echter Kopfjäger (Machete, kleiner Dolch, Messer, Blasrohr etc.), nicht gerade Vertrauen erweckend. Der erste Blick trog gewaltig! In einer Wanderung von etwa 300 km durch den Regenwald entpuppte sich Chefs als einer der sanftesten Menschen, den ich je habe kennen lernen dürfen. Er war ein echter Nomade und kannte und liebte jede Krume der Erde, in der seine Vorfahren begraben lagen. Er war Animist, und für diese zählen nur die Geister der Vorfahren. Den Kontakt zu seiner lebenden Gemeinde stellte aber sein Handy her. Später habe ich dasselbe auf den Malediven erlebt. Das aber später …
Chefs lief mit Zulassungen für alle Gebiete von Borneo dekoriert herum. Auf den Staat, der ihm die gewährt hatte, war er jedoch nicht gut zu sprechen. In seinen Augen blutete Borneo, weil die Maschinen der Holzfäller seine heimat vernichteten und sein Wasser vergifteten. Durch ihn habe ich gelernt, dass das gelbliche Wasser der Urwaldflüsse keineswegs normal gefärbt ist. Die Farbe kommt von der Erosion. Hingegen sind die gesunden Flüsse kristall-klar.
Die Reise startete mit einem Flug zu einer Touri-Attraktion von Weltrang: Die größten Höhlen der Welt. Die allergrößte von ihnen hört auf den Namen Sarawak Chamber und soll 450 m mal 600 m messen. Und sie reicht etwa 100 m in der Höhe. Da fällt das Licht der Taschenlampe müde runter, ehe es die Decke erreicht. Der Flug an sich war keine Besonderheit, aber das Einchecken. Chefs musste die diversen Waffen abgeben und legte sie einzeln auf den Tisch. Die Kontrolleure nahmen alle gelassen entgegen und verstauten sie im Bauch des großen Vogels. 9/11 war noch kein Begriff. Ich verrate lieber nicht, was man heute noch als Waffe beschlagnehmen könnte. Zuletzt haben sie noch meiner 85 Jahre alten Mutter ihre Hautschere weggenommen, die sie schon 40 Jahre in ihrer Tasche hatte. Von wegen Luftsicherheit und so. Mama als Terrorist!
Wie unterhält man sich mit einem Kopfjäger? In Englisch - Was denn sonst?

Headhunter´s Trail - Da wo sich die Kopfjäger einst den Häuserschmuck holten

Die Höhlen in Mulu sind wahrlich ein Weltwunder. Unsereins hat natürlich keine Ahnung, weil wir die Leckereien aus dem Urwald früher einfach ignoriert haben. Nicht so die Weisen des Orients, die Chinesen. Die sind so schlappe 3.000 bis 5.000 km hierher getrampelt, um sich den Grundstoff für eine Suppe zu holen - Schwalbennester. In nur einer Höhle bei Mulu leben etwa 3 Millionen von diesen Vögelchen. Sie teilen sich diese mit etwa 15 Millionen Fledermäusen, die abends ihre Schlafstätten mit den Schwalben tauschen. Der Ein- und Ausflug dauert sage und schreibe eine Stunde. Da die Putzfrau einmal alle Zehntausend Jahre kommt, sind die Höhlen wunderbar odoriert. Auf Deutsch: Sie stinken bestialisch. Die Einheimischen nennen die Duftnote "Aroma de Mulu" oder so ähnlich. Der Fußboden wippt bei jedem Tritt wie auf den Birdshit-Islands vom Great Barrier Reef, die aus dem selben Material gebaut sind.
Wenn man an die Enden der Höhlen kommt, fühlt man nicht nur den frischen Wind von draußen, sondern genießt einen der prächtigsten Anblicke, den man sich vorstellen kann. Der älteste Regenwald der Welt im Passe Partout aus Stalaktiten und Stalagmiten! Hier gibt es etwas, was man sonst häufig auch im Passe Partout sieht: Eine Grafik. Ihre Besonderheit liegt in ihrem Alter: ca. 45.000 Jahre. Ja, ja, von wegen primitive Wilde!
Der Weg zu den Höhlen ist ein Fluss, der leider nicht immer viel Wasser führt. Deswegen sind die Boote, die hier verkehren, extrem lang und flach, daher der Name longboat. Anders als ähnlich lange Boote in Thailand, laufen sie aber nicht mit Automotoren mit einer wahnsinnig langen Antriebsachse. Die Jungs hier können mit Außenbordern meisterhaft umgehen - bis das Wasser so flach ist, dass man seine Klamotten schultern und als Mannschaftssport Boote ziehen üben muss. Alle Varianten des Bootfahrens kann man hier üben.
Ich musste nicht. Täglich mehr als zwei Stunden Platzregen hatte den Fluss prall gefüllt. Wir mussten eher scharf aufpassen, dass wir nicht allzu weit in die Büsche kamen oder Bäume rammten, die scheinbar mitten im Fluss standen.
Nach einem ganzen Tag in den Höhlen wurde es wieder Zeit weiter zu marschieren. Gut gesagt! Wie läuft man aber im Platzregen, wenn der Rucksack ständig schwerer wird? Ich hatte mittlerweile gelernt, meine Sachen mit Plastikbeuteln vor dem Regen zu schützen. Das half aber dem Rucksack nicht. Beim ersten Regenguss habe ich noch schnell meine Regenjacke angezogen. Später hat sich die Sache erledigt. Bei 35º C bleibt kein Körperteil trocken, egal wie man sich gegen den Regen von Außen schützt. Dieser Urlaub sollte so ziemlich der nasseste außer den Tauchreisen werden und toppte sogar die Segelei!
Trotz der hohen Temperaturen war man ständig in Gefahr, sich zu erkälten. Diese paradoxe Angelegenheit hängt mit den Bootsfahrten zusammen, die man einlegen musste, wenn der Fluss einem keine Wahl ließ. Wenn man mit nassen Sachen und voller Schweiß so um die 15 kn Fahrt macht, fühlt sich auch Borneo zuweilen kühl an. Manchmal kriegte man während der Fahrt noch eine Husche ab.
Meine Mutter, wüsste sie dass ich hier war, würde mich fragen, was ich denn in dieser Hölle zu suchen hätte, und für die Plackerei auch noch Geld bezahle. Zu Beginn der Reise hätte ich der Dame sogar Recht gegeben. Aber nach wenigen Tagen nicht mehr. Immer wenn mir die Hutkrempe auf der Nase hing und mein Hemd voller Salz auf die Haut drückte, schimpfte ich mit mir, weil ich die Reise überhaupt angetreten hatte. Nach und nach verstummte meine innere Stimme und überließ ihren Platz einer resignativen Stille. Noch ein paar Tage weiter, fühlte ich mich sogar euphorisch.
Euphorisch oder nicht, das hauptsächlich vegetarische Essen und die täglichen Märsche von etwa 30 km zehrten so stark an mir, dass ich nach der Reise neue engere Kleidung kaufen musste. Wer seine Figur restaurieren möchte, hat es hier leichter, weil kein Kühlschrank lockt. Die Mühen, die die Natur einem abverlangt sind nichts dagegen, dass man viel zu essen besitzt, aber keinen Stauraum in der Wampe.

Zu meiner großen Überraschung sprach Chefs besser Englisch als viele Fremdlinge, die ich kenne. Er nannte zudem die lateinischen Fachnamen für die vielen Entdeckungen, die wir machten. Ich meine, die ich machte. Chefs kannte wirklich jeden Winkel des Regenwaldes und behauptete, er würde Expeditionen mit bis zu 15 Mann (bzw. Frau) ohne Proviant einen ganzen Monat führen. Die Mitglieder müssen aber mal auf den Schweinebraten verzichten und dafür von den Pilzen essen, die im Regenwald prächtig gedeihen, wenn sich die netten Wildschweine mal einen Urlaub gönnen. Oder Durian - eine Leckerei, die man nicht mit ins Hotel nehmen darf, weil sie unausstehlich stinkt. Aber im Wald schmeckt sie gewaltig.
Mit Stinken haben sie´s, manche Lebewesen im Regenwald. Auch die Rafflesia, die größte Blüte des Universums, stinkt zum Gotterbarmen. Allerdings nicht für die Fliegen, denen der Duft gilt, und die der Rafflesia trefflich munden. Die botanischen Gärten der Welt geben große Zeitungsmeldungen aus, wenn die Rafflesia in einem Gewächshaus blüht, und Gasmasken für das Personal. Von wegen, erstunken ist niemand.
Ansonsten sieht der Regenwald nicht allzu spektakulär aus. Man sieht meistens nur den Trampelpfad, den vermutlich eine Schweinerotte einst vorgetreten haben muss. Nur zuweilen, wenn das grüne Dach eine größere Öffnung aufweist, sieht man den Himmel.






Nach einem Tagesmarsch, davon etwa vier Stunden im Dauerregen, erreichten wir Camp 5. Da wehte noch der Duft des Ministers, der die Station den Trekkies gewidmet hatte. Wunderbare Holzliegen, auf die die tropische Sonne nicht scheint, weil ein Dach drüber … Man musste auch nicht unter Bäumen übernachten, wo einem alles Mögliche ins Maul fällt, wenn man schnarcht. Die Sache war leider nicht so perfekt, weil zu fortschrittlich. Man hatte die Station mit Solarstrom speisen wollen, die die Kollektoren auf dem Dach liefern sollten. Zwar scheint die Sonne hier immer, in der Regenzeit leider nur über den Wolken. Deswegen gab es nachts kein Licht. Kann mir egal sein. Ich pumpte mir von Chefs etwas Salatöl und schnitt mir einen Docht aus meinem T-Shirt ab. Fertig war das Candlelight-Dinner. Reis und Pilze, dazu etwas Urwald-Salat. Knackig frisch, weil dauernd beregnet.
Am nächsten morgen musste ich die Pinnacles rauf. Das sind vom Regen ausgewaschene spitze Felsen, genau genommen, das Gegenstück zu den Steinformationen unten in den Höhlen. Chefs wollte sich ausruhen und gab mir einen 17-jährigen Azubi-Guide und vier Liter Wasser mit. Die meisten Toten fallen hier nicht vor Hunger um, sondern aus einem Grund, der europäischen Kneipenbesuchern fremd ist: Dehydration.
Die ganze Sache schien eine Kleinigkeit zu sein. Im Gästebuch dieser Station hatten einige frühere Gäste angegeben, dass sie in drei Stunden rauf und runter waren. An dem Schild zum Trail stand zu lesen: 2,5 km! Die schaffe ich mit links! Denkste! Wir mussten zwar nur 2,5 km laufen, aber dabei die Kleinigkeit von 1200 m Höhenunterschied bewältigen. Und das bei etwa 35 º Hitze und mit einem Riesenrucksack. Die plus vier Liter Wasser drückten dauernd auf´s Gemüt. Ich musste nämlich entscheiden, ob ich die im Bauch oder auf dem Rücken den Berg hoch bringen wollte.
Mein Guide half mir dabei nicht viel - er war oben, als ich so mal 300 m hinter mich gebracht hatte. Die Jungs sind zwar toll lieb, sie können aber armen Europäern nicht nachfühlen. Wann etwa düst das Wildschwein an mir vorbei? Wird es von einem Leoparden verfolgt oder läuft es nur so zum Spaß durch die Gegend? An welchem Ende fasst man einen Blutegel an? Oh, nee! Mit solchen Banalitäten gibt sich ein Kopfjäger doch nicht ab! Mein Guide sah zwar aus, als könne er keinem ein Haar krümmen. Er war aber von der Sorte Mensch, dem man als Wildschwein besser nicht begegnet oder nur ein einziges Mal. Als Leopard? Ich schätze, auch ein Leopard muss sich vor solchen Kerlen verstecken.
Mein unaufhaltsamer Aufstieg dauerte fast vier Stunden, oder eher vier gefühlte Tage. Zuerst begleitete mich ein Italiener, den sein Führer ebenso verlassen hatte. Ab etwa 800 m war ich aber allein auf dem Weg nach oben. Das Wasser hatte ich längst ausgetrunken. Der Rucksack fühlte sich trotzdem nicht leichter an. Bei 1.000 m stieg mein Guide von seinem Olymp runter und fragte mich, ob ich doch nicht aufgeben wollte. Nein! So schlecht war die Idee allerdings nicht, man sah nämlich nichts mehr, weil wir vom Nebel umgeben waren. Naturgemäß war dies kein Nebel. Die Wolken hingen bis tief zum Camp herunter. Hoch oben einsam in der Wolke … Mir fehlte nur die Leier und der Sinn danach.
Pinnacles - oder die Hölle auf Erden, wenn man Kraxeln nur als Fremdwort kennt …



So ähnlich sah es bei meinem auf und ab aus. (Bild: leider nicht von mir, sondern aus www.allposters.com, Poster kann gekauft werden.) Jedenfalls aus meiner Sicht. Man kam aber wirklich ohne intime Kenntnisse im Bergsteigen hoch. Zwar nicht ganz aufrecht, aber ohne Anseilen und so. Die Pinnacles so steil zu fotografieren, wäre mir nicht gelungen, ich sah sie eher aus der Dackelperspektive.
Leider war es auf dem Weg nach unten etwas schwieriger, weil die echt Rasiermesser scharfen Felsen einem gehörig Angst einjagten. Erst ma´ nach oben! Mehrmals hatte mich mein Guide gefragt, ob ich denn … Am Ende sagte er "Sir, you never give up?". Ich weiß nicht, ob ich yes oder ja sagte. Egal!
Als die Tafel 1.110 m anzeigte, war meine Puste ziemlich aus. Ich war von Regenwolken umringt und sah nur noch, dass die letzten 100 m auf Aluleitern zu steigen waren. Das allerdings war gegen meine noch jungfräuliche Bergsteigerehre. So gab ich Zeichen, abzusteigen.
Der Aufstieg war nichts gegen diesen Abstieg. Der Pfad nach oben war eigentlich ein langer Wasserfall, der meistens kein Wasser führte, aber jetzt. Die Seile, die an bestimmten Stellen am Rande gespannt waren, hatten mir beim Aufstieg noch etwas Sicherheit geboten. Beim Abstieg wollte ich das aber nicht mehr glauben. Mit der Nase auf scharfe Felsen fliegen? Die Felsspitzen hat das Wasser freigelegt, so wie es unten die größten Höhlen der Welt gegraben hat. Durch die Erosion sind alle weicheren Teile der Felsen weg geschwämmt worden, übrig geblieben waren die scharfen Zacken.
Mein Helfer und Führer war schon längst unten. Ich fragte mich, wozu ich den überhaupt dabei hatte. Als ich Camp 5 wieder erreichte, lagen Chefs, mein Führer und der Italiener gemütlich auf den Brettern, die nicht die Welt, aber die Schlafstätte für heute Nacht bedeuteten. Es gab wieder Candlelight mit Salatöl und T-Shirtfetzen. Und dazu Dinner mit Urwaldsalat, Reis und Wasser.

Am Ende meiner eigentümlichen Kraxelei hatte ich einen herben Verlust zu beklagen: Die Sohlen meiner frisch in Miri erworbenen Schuhe waren durchgetreten. Man konnte durch den Schuh durchsehen. Trekking ohne Sohle? Doch nicht, wenn man mit Chefs unterwegs ist …

Yarramalong ist das Land der wilden Pferde
