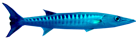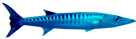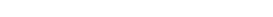

Wie kommt man nach
Nirgendwo?


Auf, zu einer wilden Tropeninsel
Die Nachrichten hörten sich wirklich sehr aufregend an. Als ich nach meiner letzten Tauchreise nach Spanien, Club Med, eher Club Mad, meine Taucherlampe zur Reparatur brachte, munkelten die Leute in dem Taucherladen von einer wahrlich tollen Reise. Auf eine wilde Insel sollte sie führen. Ich verglich schnell die Bilder aus dem Mittelmeer mit dem Erscheinungsbild von tropischen Riffen im Berliner Aquarium und war begeistert. Die letzten Zweifel am Sinn einer solchen Reise beseitigte ein Besuch im Botanischen Garten. Auf, nach La Digue. Allerdings wusste ich noch nicht, in welcher Himmelsrichtung dieses famose Land liegen sollte.
Man erzählte überall allerlei Wunderbares über die Seychellen. Schöne Menschen soll es dort geben, kreolisches Essen und Toddy, eine Art Schnaps aus Palmensaft. (Bitte gleich vergessen, es ist gesünder so!) Die Insel La Digue, die uns Quartier bieten sollte, sollte wild und fast unbewohnt sein. In unserer Aufregung fiel uns nicht auf, dass zwar jedes Detail plausibel schien, aber mit anderen unmöglich zusammen passte. Macht nichts! Allein die Vorfreude hinterließ in mir heftigere und glücklichere Spuren als manche tolle Reise. Diese Reise sollte meine erste und letzte Reise in die Tropen werden. Na, ja; eine Hälfte stimmt.
Die Reise sollte mich auch von einer großen Last befreien, dem Vietnam Krieg, der meine ganze Generation übel belastete. Wir waren doppelt deprimiert, die Leiden eines armen Volkes auf der einen Seite, die Angst vor dem Domino-Effekt auf der anderen. Einen Monat lang vergessen …
Der Termin war mit Bedacht ausgesucht worden, wir sollten auf den Seychellen weder einen tropischen Zyklon erleben, wie die Hurricanes dort genannt werden, noch die ganz große Hitze. Die kleine hat auch gereicht. Ob man auch die Insel mit Bedacht ausgesucht hat, kann ich nicht sagen. Es lag wohl eher an einem gewissen Klaus, der als Vorbote über Weihnachten dorthin geschickt worden war mit dem Auftrag, uns die Tauchbasis vorzubereiten. Dieser hat sich eher mit den Schönheiten des Landes beschäftigt, womit weder die Botanik gemeint ist, noch die Fauna. La Digue muss ihm in erster Linie aus dieser Sicht zugesagt haben. Das aber später …
Die Wahl hatte mindestens eine tolle Seite: Während der Berg auf Praslin den Ozeanwind jeden Nachmittag so in die Höhe trieb, dass es dort fast jeden Tag regnete, verschonte uns Petrus mit seinem Segen, bis auf vier Tage in einem Monat. Das will was heißen, denn auf der Hauptinsel Mahe kommt der Regen nicht nur jeden Tag so heftig runter, dass sich der höchste Punkt der Insel den Weltrekord an Regen halten soll. Für Neugierige Zahlen ohne Gewähr: Während das Land Berlin etwa 600 mm bis 750 mm Regen im Jahr abbekommt, sind es auf Praslin 2.000 bis 3.000, und auf dem besagten Punkt sollen etwa 25 m (!) Regen zusammen kommen. Auch wenn die letztere Zahl nicht ganz zutreffen sollte, viel weniger Regen als in Cherrapunji in Indien mit gesicherten 11-12 m fällt hier nicht vom Himmel. Trotzdem: Der größte Teil eines Tages ist eitel Sonnenschein. Auf La Digue waren es so an die vier Wochen. Die Insel ist aber keine Wüste, ganz im Gegenteil. Als ich sie sah, versank das einst von mir so geliebte Tropenhaus des Botanischen Gartens in völlige Bedeutungslosigkeit.
Die Reiseroute, die wir verfolgt haben, wird es so wohl nicht mehr geben, weil sich die Briten, damals noch Kolonialmacht, zurück gezogen haben. Man fliegt heute eher mit der Air France auf einem „Inlandflug“. Diese Bezeichnung soll nicht etwa ein Scherz sein, tatsächlich fliegen die Franzosen zum südöstlichsten Teil der EU (!) nach der Insel La Reunion. Die Seychellen liegen da auf dem Wege. Wer glaubt, das so ein Flug von Paris hierher doch ein ganz schön langer Inlandflug ist, sollte sich noch die „Überseedepartments“ in der Karibik und in Südamerika (Guayana) ansehen. Man kann so etwa 12.000 bis 15.000 km in „Frankreich“ fliegen. Nur die Inseln auf dem Pazifik haben die Franzosen nicht ganz in die EU mitgenommen.
Mit den Franzosen gab´s da noch eine Geschichte. Und die ist wichtiger als die Reiseroute. Sie hatten einst auch die Seychellen kolonisiert, aber nicht sehr lange. Obwohl die Briten etwa fünf mal so lange Kolonialherren gewesen sind, weigern sich die Seychellois Englisch zu sprechen, wenn sie nicht müssen. Dass sie sich auch weigern, Englisch zu kochen, kann man angesichts der Leistungen der britischen Kochkunst schon verstehen. Aber wie kommt es, dass die Leute nie warm geworden sind mit den Tommies? Die Antwort haben mir Leute aus drei Ländern mit dem gleichen Schicksal ähnlich gegeben: Die Franzosen haben sich mit dem kolonisierten Volk verstanden und sogar vermischt, während die Briten eben britisch geblieben sind.
Diese Seite hätte ich den Franzosen nie zugetraut, die überall als nationalistisch bezeichnet werden. Offenbar existiert eine Methode, wie man stolz auf seine Nation sein kann, aber andere, sogar einem Volk unterworfene, so behandelt, dass diese einen mögen. Jedenfalls wird auf den Seychellen créole gekocht wie gesprochen. Und nicht nur da … 1:0 für Frankreich!
Der bemerkenswerte Teil der Anreise ist bis heute derselbe geblieben, eine Landung auf einer ins Meer gebauten Piste. Man denkt eher an eine Wasserung denn an eine Landung. Nach einer kurzen Busfahrt gelangten wir zu einem Hafen, wo eine alte Fähre, so eine Art Frachter, auf uns wartete. Sie fuhr in die dunkelste Nacht hinaus, die ich jemals erlebt habe. Auf den Seychellen wurden damals nämlich alle Generatoren um 23:00 abgestellt, und die nächste Insel mit Dauerlicht war etwa 700 Meilen entfernt. So dunkel, wie es dort ohne Mondschein war, wird es heute vermutlich nicht einmal in Sibirien. Die Lichtverschmutzung verschont heute nicht einmal die einsamsten Orte der Welt.
Man hatte uns darauf vorbereitet, dass die Insel nicht unbedingt für Neckermänner ausgerüstet sei. Wir müssten unsere Seesäcke schultern und bis zum Bauch ins Wasser gehen, um über die Riffkante auf die Insel zu gelangen. Als der Kahn anhielt, sahen wir tatsächlich eine schwarze Gestalt, die noch dunkler schien als der stockfinstere Himmel. Wir glitten über die Bordkante ins Wasser und fühlten uns wenigstens darin sicher, dass eventuelle Ereignisse, durch Angst ausgelöst, nicht ruchbar würden. Es gab ja jede Menge warmes Wasser um uns herum.
Wir landeten an einem weißen Strand, an meinem ersten Korallenstrand im Leben. Trotz aller Dunkelheit sah er heller aus als die Insel. Und dann kam´s: Auf einmal blitzten Scheinwerfer auf und und die Palmen vibrierten im Takt von heavy metal - die Band hieß Brown Boys und hatte sich hinter den Palmen versteckt. Unser Gastgeber, ein Seychellen-Franzose namens Pierre St´Ange, hat bis zu seinem Lebensende nicht verstanden, was wir denn gegen seine Willkommens-Überraschung hatten. Eigentlich nichts - außer dass wir eine unberührte tropische Insel haben vorfinden wollen. Und Nu? Brown Boys mit 110 dB (dicht über dem Lärmpegel eines Dampfhammers), Scheinwerfer wie im Theater und Tod der Romantik der Tropen. Verstehst Du uns? Pierre verstand uns nicht! Dabei hatte er extra Verdunkelung angeordnet, um uns richtig überraschen zu können. Niemand auf der Insel hatte ein Lichtchen anzünden dürfen, damit unser Tropentraum perfekt würde.
Auch die Landung über die Riffkante war nicht echt, die Insel hatte schon damals eine Mole, heute modern Jetty genannt. Was aber anders war als bei uns, war das Transportwesen, ein alter Ochsenkarren. Allzu viel mehr existiert wohl auch heute nicht, obwohl die Insel nicht sehr klein ist.
Wir wurden in eine recht primitive, aber sehr nette Hüttenanlage verteilt, heute eher bungalow resort bezeichnet. Die Generatoren wurden nach dem ersten Drink ausgestellt und es wurde dunkel. Kaum war ich eingeschlafen, wurde ich unsanft aus dem Tropentraum gerissen. Eine Kokosnuss war auf das Blechdach gefallen. Während ich wach da lag, fiel von der Decke noch etwas Kleines auf meine Brust und krabbelte darauf. Als Kind hatte ich gelernt, bei Ankunft eines Bären mich tot zu stellen. Was aber, wenn eine tropische Spinne auf der nackten Brust rumkrabbelt? Der Bärentrick hat geholfen. Irgend wann bin ich eingeschlafen. Kein Wunder nach 16 Stunden Flug. (Anm.: Weder ich noch die Leute, die den Bärentrick erzählt haben, sind je einem Bären begegnet, der keinen Käfig um sich herum hatte.)


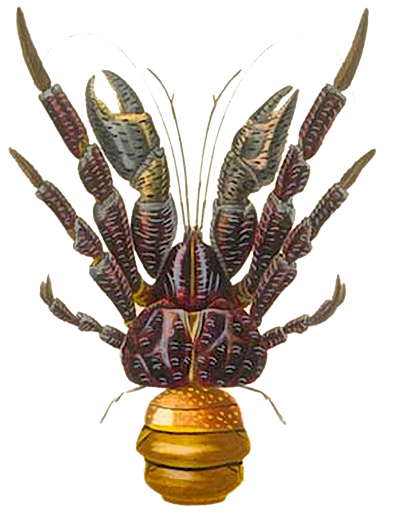



Yarramalong ist das Land der wilden Pferde