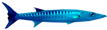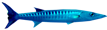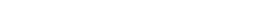

Naturreservat Lokobe
Eines Tages überzeugte mich ein netter Mensch davon, dass ich doch ein Touri sei und Dinge tun muss, die solche Personen zu tun pflegen, z.B. die Natur ansehen. Er war so lieb und nett, dass ich nicht nein sagen konnte. Da war natürlich noch die Frage des Preises. Er druckste etwas herum und kam mit einer horrenden Zahl raus: 30 Euro sollte ein ganzer Tag mit Essen kosten. Dazu etwa drei Stunden mit dem Taxi, etwa zwei Stunden mit dem Boot und, nicht zu vergessen, Besuch des Naturschutzgebietes. Ich gab mich erschüttert und versuchte zum Schein, billiger davon zu kommen. Es ging nicht. Leider wurde es am Ende sogar teurer, weil der Preis nur ab zwei Personen galt. Aber niemand wollte diesen schönen Tag mit mir teilen. Ein Glück, denn das Taxi war auch mit einem einzigen Touri überladen. Denn meine Entourage musste auch mit dem selben Taxi reisen. Und die war nicht gerade klein.
Wir sollten nach dem Dorf Lokobe fahren, einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet. Bei den luxuriösen Preisen hatte ich mindestens eine Stretch-Limousine erwartet, musste aber mit einem Vehikel meiner Jugendjahre fahren, mit einem R4, der Antwort von Renault auf Citroen 2CV, auch Ente genannt. Die Insel Nosy Be scheint eine der letzten Bastionen dieses Autos zu sein, die von ganzen Flotten des prähistorischen Wagens bevölkert wird. Während der Fahrt verstand ich, wieso gerade dieses Auto in diesem Land überlebt hat: Seine hohen Beine sorgen dafür, dass es nicht in den Schlaglöchern verschwindet. Allerdings bezeichnet dieses Wort den Zustand der Straße nicht ganz, weil es mehr Straße als Lücke dazwischen bedarf, um von Schlaglöchern zu reden. Auf Nosy Be ist das Verhältnis nicht selten umgekehrt.
Die Reise begann in Madirokely, dem Ort, den man nur über große Pfützen verlassen kann. Die Fahrtroute ähnelt einem Riesenslalom, nur dass die Tore hier nicht gesteckt sind. Da wir nur zu dritt waren, meisterte der R4 die Tor-Tour mit Bravour und gelang auf den Asphalt nach Hellville. Dort parkten wir das Gerät vor dem großen Schnaufer, dem Diesel des Kraftwerks.
Nach der unerlässlichen Bunkerung von Wasser begann das Warten auf Frau Didier. Sie musste sich irgendwie vertan haben. Nein, sie schleppte sich mit Kochgeschirr und allerlei Utensilien für ein Essen zu fünft ab. Denn wir mussten auch noch den Kapitän der Pirogge mitnehmen, die uns zu dem Ort Lokobe bringen sollte. Ach ja, auch der Schiffsjunge musste sich irgendwie ins Auto quetschen.
Der R4 schnaufte los und verlangte bereits nach wenigen Kilometern nach Frischwasser. Diese Szene sollte sich häufig wiederholen. Der Fahrer stieg aus, gab dem Auto zu trinken und streichelte es. Solch ein Auto muss man in Laune halten. Wenn ein Teil kaputt ginge, könnte man gezwungen sein, im nationalen Automuseum in Paris einzubrechen und eines der Exponate zu entwenden. Auf Nosy Be geht es mit Streicheln, während Vehikel der gleichen Altersklasse im Orient mit Gebetstafeln oder gar Amuletts in Laune gehalten werden.
Nach einer halbe Stunde ordentlichen Weges bogen wir ab in etwas, was mir wie ein Bachlauf erschien, dem das Wasser entwichen sein musste. Keine Sorge, das war die Straße. Vorbei an Ylang Ylang-Bäumen, Vanilleplantagen und nicht zu wenigen Menschen näherten wir uns langsam aber unsicher einem Dorf. Vorher mussten wir das Auto einige Male verlassen, damit es über die Steine rollen konnte. Solche Szenen habe ich in meiner Jugend häufig erlebt, aber nicht ganz. Hier mussten wir nicht schieben, da der Fahrer ein wahrer Künstler war. Der durstige und ebenso rostige Autogreis hat nicht ein einziges Mal versucht, sich eine extra Pause rauszuschinden.
Eigentlich hätten wir diesen Teil der Tour zu Fuss lässig schneller erledigt. Sowas ist aber gegen die Ehre. Man zwängt sich in den heißen und engen Kasten und schwitzt neuen Abenteuern entgegen. Diese finden allerdings nicht statt, weil man von so vielen guten Geistern umgeben ist, dass einfach nichts passiert.
Endlich fuhren wir in das Dorf ein, das den Hafen nach Lokobe bilden sollte. Leider hatte sich der Hafen anders überlegt und sich etwa einen Kilometer zurück gezogen - Ebbe. Die Mangroven sahen ohne Wasser darunter eher wie eine Olivenplantage aus. Wir mussten stramm über den Sand marschieren, bis in der Ferne die Pirogge erschien. Rein in den Kahn und in die Hände gespukt; Touris sind zwar hohe Herren, sollten aber genug Pflaster bei sich tragen, damit sie keine offenen Hände bekommen. Offene Hand ist das handliche Gegenstück zum Wolf, den man sich erreiten kann.
Mein Guide hieß und heißt Didier. Er hat nichts mit den Figuren zu tun, die man woanders für solche Aufgaben mieten kann. Er wirkt eher schüchtern und könnte eher ein Kolonialbeamter, Lehrer oder ähnlich sein.
Didier hofft immer, dass einer seiner Kunden ihn weiter empfiehlt. Dies fällt übrigens nicht schwer, ist er doch stets bemüht, einen zufrieden zu stellen. Und Deutsch spricht er auch noch - eine Seltenheit in diesem Land.
Er arbeitet mit seiner Frau zusammen, die als Koch mindestens vier Sterne abbekommen würde. Sie erstellt schöne Stickereien, die etwas von einem Kunstwerk haben, dennoch ist sie sehr, sehr bescheiden.
Irgendwie kam ich mir äußerst schäbig vor, beide zu einem lächerlichen Preis für einen ganzen Tag zu beschäftigen.
Wie viele Leute passen in einen R4?
Nach etwa 45 Minuten Paddelei erreichten wir einen schönen Strand, leider in einem Zustand, bei dem windige Makler am liebsten Land verkaufen. Da das Meer hier sehr flach ist, zieht sich das Meer bei Ebbe sehr weit zurück. Das Boot wurde zuerst gezogen, später etwas angehoben geschleppt. Nach und nach mussten alle Insassen es verlassen, damit es möglichst weit schwimmen konnte. Irgendwann mal erreichten wird das Dorf, eine kleine Siedlung, die die ersten Touris des Tages begrüßen wollte. Leider stand ich allein da, andere waren heute nicht gekommen.
Nach einem - gut gekühlten - Drink nahm mich Didier zusammen mit dem Kapitän in den Wald. Dieser trug eine Machete in der Hand und gab so der Prozession den Anschein einer Afrikanischen Safari im Regenwald, wie man sie aus alten Filmen kennt. Wenn jetzt Tarzan auftauchen würde, würde ich mich nicht wundern, aber er. Denn die meisten Lianen hier hören auf den Namen Vanille. Sie ist, obwohl in einem Schutzgebiet präsentiert, nicht endemisch, sondern mexikanisch. Die große Leistung der Madegassen bestand darin, die Vanille so zu überlisten, dass sie sich selbst bestäubt. Allerdings müssen flinke Hände jeder Blüte einzeln beibringen, wie man sich selbst … Jede zweite Vanilleschote, die ihren Weg in Eistüten oder sonstige Leckereien findet, kommt aus Madagaskar, und zwar nicht die schlechtesten, sondern die besten.
Als wir den zivilisierten Teil des Schutzgebietes verlassen hatten, begannen meine beiden Begleiter, mich in die Geheimnisse der Natur einzuweihen. Z.B. lernte ich, wie man mit einer Machete Wasser aus dem Reisebaum holt. Mit meinem Leatherman würde ich vermutlich verdursten. Der ist ja auch für Texanische Cowboys gemacht und nicht für Amateurexpeditionen in den Tropen. Nicht weit davon entfernt schlängelte sich eine Python in einem Baum. Kurz danach trafen wir eine tropische Spinne in einem mächtigen Netz. Als wir auf eine tobende Herden Lemuren stießen, wusste ich endlich, woher ich das Ganze hier kannte. Ein Mittaucher hatte einige Tage vorher von einer „Urwaldtour“ erzählt, auf der er vielen exotischen Tieren begegnet war. Ob die Sache als Wunder mit einigen Ereignissen der Religionsgeschichte mithalten kann, vermag ich nicht zu urteilen. Ganz schön wunderähnlich war sie dennoch, denn mein Mittaucher hatte alles in der gleichen Reihenfolge erlebt wie ich. Eine Spinne, eine Pythonschlange und eine Horde Lemuren in eine bühnenreife Zeitdisziplin zu bringen, könnte von manchen Menschen sogar höher bewertet werden als ein Wunder.
Ich ließ meine Führer in dem Glauben, dass ich Allem Glauben schenken würde. Dennoch - im Regenwald musste ich manchmal mehrere Tage marschieren, bis ich ähnlich viele Tiere habe sehen können. Hier hatte Mutter Natur das Szenario so arrangiert, dass ich pünktlich zum Mittagessen alle Wunder hinter mir hatte.
Die Lemuren sind so ziemlich das Wichtigste an Tierarten, die Madagaskar zu bieten hat. Einmalig ist nur eine leichte Übertreibung, sie kommen auch auf den Komoren vor. Lemuren, Feuchtnasenaffen in anderer Bezeichnung, sind gar nicht so affig, sondern äußerst intelligent und können auch die Bananenteile zählen, die man in der Hand versteckt. Erst wenn alle Bananenstücke, die Didier mit dem Messer - nicht mit der Machete - zerschnippelt hatte, weggegessen waren, sind die Tierchen im Wald verschwunden. Allerdings müssen sie uns immer verfolgt haben, denn sie waren sofort da, wenn die nächste Ration Banane verteilt war. Sie hüpften wild von Baum zu Baum, dann auf den Kopf von Didier oder auf meine Schultern. Zauberhafte Wesen, von denen manche den Tag und andere die Nacht als lohnenden Lebenszeitabschnitt betrachten. Die Lemuren der Nacht schliefen während des Spektakels eng verschlungen mit sich oder mit einem Artgenossen unterm Blätterdach. Von uns ließen sie sich überhaupt nicht stören.
Wie sich Vanille mit Naturschutz verträgt, habe ich nicht verstanden. Man müsste sie, wollte man Madagaskar natürlich halten, eigentlich mit Haut und Haaren, Pardon Blättern und Wurzeln, rausrupfen und in Mexiko kompostieren. Leider wäre dann Madagaskar viel ärmer als es ohnehin ist.
Die Tour habe ich genossen, auch wenn sie halb so wild war.
Wildnis gezähmt
Zurück im Dorf hatte sich die Szene gewandelt. Man hatte einige Verkaufsstände aufgebaut, an denen Holzschnitzereien u.ä. verkauft wurden. Allerdings gibt es in Lokobe etwas nicht, was man fast an allen Touristenorten bekommt: die omnipräsenten Artikel für Touristen. Diese sehen überall auf der Welt gleich aus, so dass man sich überlegt, wozu man denn das Zeug mitschleppt. Peinlich, wenn man einem Türken einen Gürtel aus Amerika schenkt und da steht „Made in Turkey“ auf dem Etikett. Schlimmer noch, ein Korb, erstanden im Regenwald auf Borneo, mit einem Schild aus Brasilien. Ach, ja. Da gibt es noch etwas Regenwald.
Nach wenigen Minuten wurde das Essen serviert, das von Frau Didier zubereitet worden war, als wir uns in der Wildnis rumgetrieben hatten. Es gab Fisch und Krebse, dazu Salat. Alles sehr lecker und vor allem, liebevoll serviert. Allein für dieses Essen hätte ich locker 10 Euro bezahlen müssen - hier, und nicht in Europa, wo ich hätte den Tageslohn meiner Begleiter hätte lässig berappen müssen. Madame hatte sich als Künstlerin geoutet, erst einmal als Kochkünstlerin.
Nach dem Essen durften wir wieder an die Riemen. Diesmal musste man nicht weit laufen, die See hatte das Boot kurz vor das Dorf gebracht. Auch die Rückfahrt verlief anders, wir paddelten an Felsen entlang, die am Vormittag in weiter Ferne gelegen hatten. Die Mangroven standen nunmehr im Fussbad und sahen in dem ruhigen Wasser einfach himmlisch aus.
Im Dorf versuchte man mir Fisch zu verkaufen, den sie reichlich gefangen hatten. Leider war mir nicht danach, weil einige Stunden unter der Tropensonne dem Fisch nicht gut tun. Und einen Kühlschrank besaß mein Taxifahrer in seinem musealen Gefährt nicht.
Auf dem Rückweg mussten wir einige Male häufiger als auf dem Hinweg aussteigen, ein paar mal dem Auto zu trinken geben, und nett schwitzen. In edlen Stretchlimousinen würde man transpirieren, im R4 wird profan geschwitzt.
Didier wollte als Krönung des Tages mir noch eine Handarbeit seiner Frau verkaufen, eine Tischdecke für einen runden Esstisch samt Servietten. Eine wunderbare Applikationsarbeit. Ihm widerstrebte einfach, mir meine Anzahlung zurück zu geben, nachdem er die Scheinchen in der Tasche aufgewärmt hatte. Das hätte er lieber sein lassen sollen. Denn zurück in meinem Hotel nahm die Dame von der Bar, Nathalie, die Decke fachkundig unter die Lupe. Auf ihrer Stirn kräuselten sich tiefe Falten. Didier, der sich schon verabschiedet hatte, erschien Sekunden später und sagte mir ungefragt, selbstverständlich werde Madame Didier morgen kommen und einige Änderungen vornehmen. Sie ist Schwägerin von Nathalie und war nun in der Prüfung durchgefallen.
Jetzt liegt die Decke bei uns auf dem Esstisch und wird heiß geliebt. Madame ist eine wahre Künstlerin.


















Yarramalong ist das Land der wilden Pferde